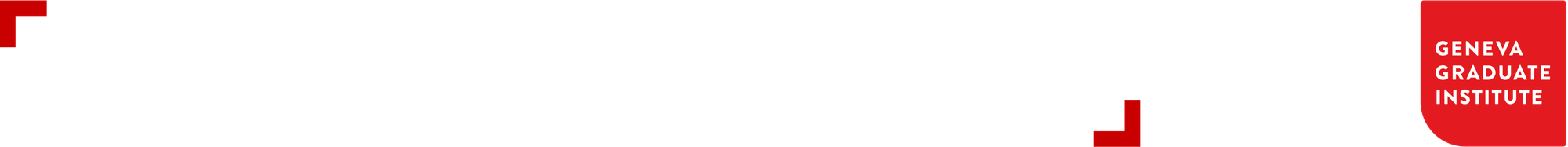Achim Wennmann
„In außergewöhnlichen Momenten ist alles möglich“, sagte Jean Monnet, der nach dem Zweiten Weltkrieg Pionierarbeit beim Aufbau eines vereinten Europas leistete. Doch um die Gunst der Stunde für Veränderungen zu nutzen, braucht es Voraussicht, gute Vorbereitung und einen klaren Plan. Der Geneva Policy Outlook 2025 (GPO25) orientiert sich in seiner diesjährigen Ausgabe an diesen Eigenschaften und geht davon aus, dass Genf über alle Voraussetzungen verfügt, um einen solchen „außergewöhnlichen Moment“ zu nutzen, um den Multilateralismus neu zu erfinden.
Diese Neuerfindung findet jedoch in einer Zeit statt, in der ein neuer politischer Mainstream der internationalen Zusammenarbeit mit großer Skepsis gegenübersteht, eine Tendenz, die durch die Wahlen in den USA noch verstärkt wurde. Angesichts der Realität eines „Multilateralismus in der Krise“ und der zugegebenermaßen beunruhigenden finanziellen Aussichten ist die Botschaft für 2025 klar: Damit Genf relevant bleibt, braucht es mehr als ein „Weiter so“.
Aus diesem Grund konzentriert sich die diesjährige Ausgabe des GPO25 auf mutige Ideen und Praktiken, die dazu beitragen können, dass Genf – und damit auch der Multilateralismus im weiteren Sinne – als internationale Drehscheibe für Diplomatie und internationale Zusammenarbeit relevant bleibt. Der GPO25 zeigt auch, wie politischem Innovationsgeist in den Bereichen geistige Eigentumsrechte, Gesundheitsdiplomatie, Biodiversität und Friedenskonsolidierung Erfolge verbuchen können, und weist auf Zukunftsthemen hin, die die Welt im Auge behalten sollte.
Auf dem Weg zum Multilateralismus 2.0
Da sich in der Weltpolitik derzeit so viel ereignet, wird im ersten Abschnitt die Bedeutung einer nüchternen Beurteilung von Kontinuität und Wandel als Leitfaden für die Entscheidungsfindung hervorgehoben, die nach Ansicht des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan für die Bewältigung aller Krisen unerlässlich ist.
Jussi Hanhimäki nimmt sich diesen weisen Rat zu Herzen, um die US-Wahlen und ihre Auswirkungen auf Genf zu entmystifizieren, indem er den Blick auf die allgemeinen Tendenzen der US-Außenpolitik richtet. Als Supermacht wehren sich die USA traditionell gegen die Vorstellung, dass sie internationale Institutionen finanzieren oder für die Lösung internationaler Probleme mitverantwortlich sein sollen. Diese Haltung dürfte sich unter der neuen US-Regierung noch verstärken und zu einem „Multilateralismus à la carte“ führen. Hanhimäki plädiert dafür, Trump 2.0 einen Multilateralismus 2.0 entgegenzusetzen und begründet dies mit der einfachen Tatsache, dass „Die Zukunft des Multilateralismus kann nicht von den politischen Strömungen in einem einzelnen Land abhängen, egal wie mächtig und reich es auch sein mag.“ Die praktische Konsequenz dieses Arguments ist eine intensivere Diplomatie über die Verteilung von Lasten, Verantwortung und Macht, um ein inklusives multilaterales System - einen „Multilateralismus 2.0“ – aufzubauen.
Hugo Slim bringt die Diskussion über die Neuerfindung des Multilateralismus in die Genfer Welt der Global Governance. Er argumentiert, dass Genf seinen „toten Winkel in Bezug auf die Natur“ überwinden und „die Doktrin der Menschlichkeit vertiefen“ muss, die sich derzeit auf eine Diplomatie konzentriert, die auf den Menschen ausgerichtet ist, wie zum Beispiel durch die Arbeit zu Menschenrechten, Gesundheitsdiplomatie und der Humanitären Hilfe. Ein neuer Multilateralismus in Genf müsse die „gemeinsame Identität und unsere gemeinsamen Interessen mit der größeren Erdgemeinschaft von Pflanzen, Tieren und ihren Ökosystemen“ anerkennen. Von der Betonung des One Health-Ansatzes bis hin zu Verhandlungen über die friedliche Nutzung gemeinsamer Ressourcen wie Wasser oder Ökosysteme sind bereits praktische Bemühungen im Gange, die eine ganzheitlichere Doktrin der Menschlichkeit verkörpern. Für Genf ist dies eine Gelegenheit, sich proaktiv dafür einzusetzen, dass die Natur von einem „ständigen Beobachter“ zu einem „ständigen Mitglied des internationalen Genfs“ wird.
Marie-Laure Salles führt diese Argumentation weiter, indem sie vorschlägt, dass sich die Zukunft Genfs als internationaler Knotenpunkt um eine neue, stärker integrierte Agenda der Nachhaltigkeit entwickeln sollte. Diese Agenda basiert auf drei Hauptprinzipien: die Menschheit wieder mit der Natur zu verbinden, die Menschen wieder miteinander zu verbinden und die Menschen wieder mit sich selbst zu verbinden. Die neue Agenda würde die vielen bereits bestehenden Akteure und Initiativen mobilisieren, um regenerative Ansätze, eine Neufassung des Gesellschaftsvertrags und die Entwicklung von Technologien, die auf den Menschen und den Planeten ausgerichtet sind, neu zu beleben. Salles betont: „Genf hat alles, was es braucht, um sich als Drehscheibe dieses epochalen Wandels neu zu erfinden … Diesen Aufruf dürfen wir nicht verpassen!“
Ein neues multilaterales System brauche auch ein angepasstes Gründungsdokument, so Heba Aly. Sie denkt über eine neue Initiative nach, um die Charta der Vereinten Nationen auf der Grundlage von Artikel 109 zu aktualisieren. Aly skizziert die Gründe und die aktuelle Bewegung, die hinter diesen Initiative steht. Ihrer Meinung nach „Auch wenn diese Bestrebungen auf zahlreiche Hindernisse stoßen, so ist doch angesichts der vielen Regionen der Welt, denen die gegenwärtige Weltordnung keine guten Dienste leistet, ist ein neues System der Weltordnungspolitik unumgänglich.“ In einem weniger politisierten Umfeld als New York sei „Genf ideal, um mutige Ideen für die Zukunft des Multilateralismus zu entwickeln“, so auch die Reichweite einer normativen Erneuerung der UN-Charta. Eine „UN-Charta 2.0“ könnte auch ein Weg für eine jüngere Generation sein, die internationale Zusammenarbeit zu entdecken und schätzen zu lernen.
Solomon Dersso betont die Notwendigkeit eines viel stärker vernetzten Multilateralismus, der im Falle Afrikas der wachsenden politischen Handlungsfähigkeit des Kontinents Rechnung tragen könnte. Er schlägt insbesondere vor, eine engere Verbindung zwischen zwei Knotenpunkten zu entwickeln: Addis Abeba als regionaler Knotenpunkt für die afrikanische Region und Genf als internationaler Knotenpunkt, was zu einem internationalen und weniger auf die Länder der nördlichen Hemisphäre ausgerichteten Multilateralismus beitragen würde. Dieses Bestreben würde es ermöglichen, „die Rolle der Afrikanischen Union zu nutzen und ihre Mitglieder [...] zu einem wichtigen Stimmblock in den Vereinten Nationen zu machen“, um den Austausch über Friedens- und Sicherheitsfragen, Menschenrechte und die afrikanische kontinentale Freihandelszone zu verbessern. Das Jahr 2025 bietet die Gelegenheit, den Austausch auf diesen verschiedenen Wegen zu erproben, mit dem Ziel, „einen stärker vernetzten Multilateralismus zu knüpfen“.
Richard Gowan schließt diesen Abschnitt mit Empfehlungen für all diejenigen ab, die eine Reformagenda innerhalb des UN-Systems vorantreiben wollen. Er empfiehlt ihnen, den UN-Zukunftspakt als Instrument der Lobbyarbeit zu nutzen. Zwar könne der Pakt keinen konkreten Strategieplan zur Bewältigung globaler Herausforderungen bieten, aber es gebe Lobbyisten eine „Auswahl an Optionen“ an die Hand. So bietet er beispielsweise „Menschenrechtsexperten auch einige vereinzelte Öffnungen, die einen grundrechtlich basierten Ansatz in der Konfliktprävention und -bewältigung zu mehr Geltung verschaffen“ können. Insgesamt könne der Pakt auf dem Weg zu großen Zielen hilfreich sein, da er „Ideen und Sätze, die kluge politische Vordenker für ihre jeweiligen Agenden nutzen können“.
Der Geneva Policy Outlook 2025 eine Reihe von Orientierungshilfen auf dem Weg zu einem „Multilateralismus 2.0“.
Insgesamt bietet der Geneva Policy Outlook 2025 eine Reihe von Orientierungshilfen auf dem Weg zu einem „Multilateralismus 2.0“. Dazu gehören die Priorisierung einer nüchternen Bestandsaufnahme von Kontinuität und Wandel; die Identifizierung von toten Winkeln, die Aufmerksamkeit bedürfen; eine verbindende Agenda für Nachhaltigkeit, die dem Multilateralismus einen klaren Zweck zuweist; die Bedeutung einer Aktualisierung der Gründungstexte, damit sie die heutigen Realitäten widerspiegeln; der Aufbau eines vernetzten Multilateralismus, der neue Räume politischer Handlungsfähigkeit anerkennt; und die Stimulierung von politischem Innovationsgeist. Diese Elemente allein sind nicht in der Lage, einen „Multilateralismus 2.0“ zu gestalten. Sie stellen jedoch Arbeitsfelder dar, die bis 2025 in Angriff genommen werden könnten, um bei der Neuerfindung des Multilateralismus den Worten Taten folgen zu lassen.
Diplomatie in Aktion
Der zweite Teil des GPO25 konzentriert sich auf drei Beispiele von politischem Innovationsgeist. Diese sind aus den verschiedenen vom Geneva Policy Outlook im vergangenen Jahr organisierten Dialogen herausgewachsen. Diese Artikel zeigen, dass Genf nach wie vor eine der wichtigsten diplomatischen Plattformen und eines der führenden politischen Laboratorien der Welt ist. Genf hat viel zu bieten, um die Neuerfindung des Multilateralismus voranzutreiben.
Margo A. Bagley zeichnet den Weg zum Konsens über das Abkommen über geistiges Eigentum, genetische Ressourcen und damit verbundenes traditionelles Wissen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), besser bekannt als das GRATK-Abkommen, nach. Sie beleuchtet, wie das sich verändernde geopolitische Umfeld mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine den Weg für Opportunismus ebnete und so den entscheidenden Impuls für die Verhandlungen gab. In gewisser Weise war der Krieg in der Ukraine jener „außergewöhnliche Moment“, von dem Monnet im obigen Zitat spricht und den die Verhandlungsführer nutzten, um den Verhandlungsprozess so zu gestalten, dass er zu einem erfolgreichen Abschluss kam. Das GRATK-Abkommen ist eine Geschichte traditioneller Diplomatie vom Feinsten, die sorgfältige Vorbereitung, einen ausgewogenen Text des Vorsitzenden, geschickte Konsensbildung und die Unterstützung der WIPO und zahlreicher Verhandlungspartner hinter den Kulissen beinhaltet. Der Erfolg des GRATK-Abkommens zeigt, dass es im Rahmen der allgemeinen Diskussionen über die Neuerfindung des Multilateralismus Raum für Verhandlungen auf technischer Ebene in spezialisierten internationalen Organisationen gibt. Es beweist, dass eine solche multilaterale Diplomatie funktionieren kann, wenn auch in ihrem eigenen Rhythmus, was in diesem Fall etwa zehn Jahre Verhandlungen bedeutete.
Leider können sich die Verhandlungen über das Pandemieabkommen einen solchen Zeitrahmen nicht leisten. Suerie Moon betont, dass die Verhandlungen aufgrund der Gefahr einer weiteren globalen Pandemie beschleunigt werden sollten, aber einige schwierige Themen noch nicht vom Tisch seien. Dies betrifft vor allem den gerechten Vorteilsausgleich zu Krankheitserregern (Access and Benefit Sharing, PABS) sowie den Rückgang der Entwicklungshilfe von wichtigen Geberländern. Es ist wahrscheinlich, dass die neue Trump-Administration zu diesen Herausforderungen beitragen wird. Dennoch bleibt die den Verhandlungen zugrunde liegende Annahme bestehen: „Die Welt wird sicherer sein, wenn sich Regierungen bis 2025 auf faire und wirksame Richtlinien für den Umgang mit Pandemien einigen.“ Angesichts des geopolitischen Kontextes und der fundamentalen Herausforderungen, die mit den Schwerpunktthemen verbunden sind, bieten die Verhandlungen über das Pandemieabkommen in Genf einmal mehr Gelegenheit für Diplomatie vom Feinsten.
Neben der Dynamik der Verhandlungen zu bestimmten Themen zeigt Genf auch in anderen Bereichen politischen Pioniergeist.Tony Rinaudo, Juliet Bell und Athena Peralta berichten über ihre Erfahrung, wie der Übergang von programm- zu netzwerkfokussierten Interventionen mehr Nutzen bringt. Die Autoren analysieren die Ergebnisse von Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR), einer von Landwirten selbst verwalteten natürlichen Regenerationsmaßnahme, die einen kostengünstigen und wirkungsvollen Ansatz zur Wiederbegrünung verarmter Böden durch Nutzung der vorhandenen Vegetation bietet. Allein in Niger wurde durch FMNR eine Ackerfläche wiederbegrünt, die größer ist als die Fläche der Schweiz. Weltweit wurde bereits die vierfache Fläche regeneriert. FMNR ist auch ein strategisches Instrument zur Ernährungssicherung. Umfang und Relevanz der Maßnahme werden derzeit durch Kollaboration mit Glaubensbewegungen wi auch durch politische Lobbyarbeit ausgeweitet. Wichtige Arbeitsfelder sind Landbesitzstrukturen, finanzielle Anreize für Landwirte und die Integration von FMNR in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Strategien zur Risikominderung im Katastrophenfall. Für FMNR-Verfechter wirkt Genf als Verstärker da die Stadt eine Plattform für Weltpolitik ist und Zugang zu Netzwerken religiöser Institutionen bietet.
Hiba Qasas stellt die kühne Idee einer Friedensbemühung für Israel und Palästina vor. Sie argumentiert, dass „der gegenwärtige Ansatz bringt weder Sicherheit für Israel noch Würde und Selbstbestimmung für die Palästinenser. Echter Realismus bedeutet heute anzuerkennen, dass Frieden alles andere als ein idealistischer Luxus ist, sondern der einzige pragmatische Weg nach vorn.“. Sie betonte, dass es „auf beiden Seiten Partner für den Frieden“ gebe, die zusammenarbeiten wollten. Diese bauen eine gemeinsame Gruppierung auf, die sich an fünf Leitprinzipien orientiert: gegenseitige Anerkennung des Rechts beider Seiten auf Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit; Schutz und Sicherheit; Würde; Handlungsfähigkeit und Inklusion; und Vertrauen durch Heilung. Es gibt eine Chance, eine andere Realität für Israel und Palästina aufzubauen als „einen endlosen Kreislauf der Gewalt“, und es ist an der Zeit, diese Chance zu ergreifen.
Genf eine Quelle oder ein Beschleunigungsfaktor für mutige Ideen ist, die dann andernorts weiterverfolgt werden können. Diesen sicheren Raum für strategische Entwicklung, Netzwerkbildung und Problemlösung über Themen, Sektoren und Positionen hinweg zu ermöglichen und zu schützen, wird sich als entscheidender Faktor erweisen, Genf als internationale Drehscheibe relevant zu halten.
Die oben genannten Beispiele zeigen, dass Genf eine Quelle oder ein Beschleunigungsfaktor für mutige Ideen ist, die dann andernorts weiterverfolgt werden können. Diesen sicheren Raum für strategische Entwicklung, Netzwerkbildung und Problemlösung über Themen, Sektoren und Positionen hinweg zu ermöglichen und zu schützen, wird sich als entscheidender Faktor erweisen, Genf als internationale Drehscheibe relevant zu halten.
Neue Themen im Auge behalten
Es gibt eine lange Liste von wichtigen Themen, die von solch einem sicheren Raum für politische Innovation profitieren könnten. Der GPO25 beleuchten drei solcher Themen, die sich aus unserer Arbeit im vergangenen Jahr herauskristallisiert haben.
Das erste Artikel beschäftigt sich mit den „neuen Massenvernichtungswaffen – genauer gesagt, mit den Massen-Desinformationswaffen“. Jean-Marc Rickli betont, wie wichtig es sei, die Diplomatie zu ermutigen, gegen die KI-gestützte Desinformationsmaschinerie vorzugehen. Wenn nichts unternommen werde, bestehe die Gefahr, dass diese Maschinerie die Demokratien vollständig zerstöre, indem sie vor allem „Zweifel an der Legitimität der politischen Institutionen und an den Ergebnissen der demokratischen Prozesse“ säe. Angesichts der rasanten Entwicklung der Desinformationstechnologien, die uns in Zukunft bedrohen werden, ist es höchste Zeit, eine multilaterale Antwort zu finden. „Genf befindet sich in einer einzigartigen Position, um zum Dreh- und Angelpunkt der globalen Gouvernanz im Kampf gegen Desinformation zu werden und ein neu entstehendes Regime der Desinformations Kontrolle zu schaffen“, das ähnlich funktioniert wie das Regelwerk zur Rüstungskontrolle. Solche Bemühungen würden auch die Bedeutung von Themen wie Demokratie und partizipativer Politik auf der Agenda des internationalen Genfs unterstreichen.
Der zweite Artikel befasst sich mit der Ausarbeitung einer konkreten Initiative, die Mikroplastik, Gesundheit und sozioökonomische Stabilität miteinander verbindet. Aditya Bharadwaj warnt, dass sich die Forschungsergebnisse zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik verdichten und deutet, dass „diese Ergebnisse auf die Möglichkeit erheblicher Reproduktion Schäden“ hinweisen. Bharadwaj betont, dass sich die meisten politischen Initiativen zu Mikroplastik auf die Umweltverschmutzung und Strategien zur Abfallvermeidung und -beseitigung konzentrieren, nicht aber auf die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Dies ist eine wichtige Gelegenheit für das politische Ökosystem Genfs, eine Brücke zwischen den Lagern von Mikroplastik und der globalen Gesundheit zu schlagen, um ganzheitliche politische Richtlinien zu entwickeln und ein neues Aktionsbündnis zu konstituieren.
Der dritte Artikel ist ein „Bericht von der Front“, der zeigt, wie schlecht gemanagte Emissionshandelsprojekte in Afrika Konflikte schüren. Das Ziel der Emissionsgutschriften ist ein „vierfacher Gewinn“, der die Sanierung des Bodens fördert, den Landwirten ein höheres Einkommen beschert, mehr CO2 bindet und es Unternehmen ermöglicht, treibhausgasneutral zu werden. Irene Ojuok und Alan Channer warnen jedoch davor, dass die Klimaschutzfinanzierung Konflikte in Gemeinden und Familien auslöst und sich vor allem negativ auf Frauen und Jugendliche auswirkt. Sie betonen, wie wichtig es ist, eine Bewertung der Konfliktrisiken in die Machbarkeitsstudien zum Emissionshandel einzubeziehen, und heben die wichtige Rolle hervor, die Genf dabei spielt, den ländlichen Gemeinschaften Afrikas in der Interaktion mit den wichtigsten Wirtschaftsakteuren Gehör zu verschaffen. Diese Warnungen verdeutlichen, wie wichtig ein kontinuierliches Monitoring und ein iterativer Gestaltungsprozess bei der Umsetzung der Klimaschutzfinanzierungsagenda sind.
Unter Berufung auf Jean Monnet bekräftigt Marie-Laure Salles in ihrem Artikel die Art von Führungsverantwortung, die dazu beitragen kann, Genfs Suche nach Relevanz als internationaler Knotenpunkt in einer sich rasch verändernden Welt zu lenken. Dieses Streben erfordert ein Umdenken weg von der relativen Bequemlichkeit und der Betonung der Beständigkeit hin zu einer aktiveren Form der Erneuerung, der Neuerfindung und der Pionierarbeit. Als internationale Drehscheibe kann Genf als Hüter von Idealen und Werten auftreten, einen vertrauenswürdigen Raum für Diplomatie bieten und sicherstellen, dass alle Stimmen in multilateralen Prozessen gehört und berücksichtigt werden.
Im Jahr 2025 werden also „alle Mann an Deck“ gebraucht, damit Genf seine Rolle in einer neuen Weltordnung finden kann und damit Diplomatie und internationale Zusammenarbeit die wichtigsten Instrumente der Weltpolitik bleiben.
Diejenigen, die den gegenwärtigen „außergewöhnlichen Moment“ nutzen wollen, um den Multilateralismus in Genf neu zu erfinden, können auf die Instrumente, Netzwerke und Kompetenzen eines der weltweit führenden Knotenpunkte für politischen Innovationsgeist zurückgreifen. Aber sie sollten es wirklich jetzt tun, bevor sich finanzielle und politische Kräfte und Selbstvertrauen in anderen Städten vereinen, um internationale Zusammenarbeit auf ihre eigene Weise voranzubringen. Im Jahr 2025 werden also „alle Mann an Deck“ gebraucht, damit Genf seine Rolle in einer neuen Weltordnung finden kann und damit Diplomatie und internationale Zusammenarbeit die wichtigsten Instrumente der Weltpolitik bleiben.
Über den Herausgeber
Prof. Achim Wennmann ist Direktor für strategische Partnerschaften am Geneva Graduate Institute, wo er auch Professor für Praxis im interdisziplinären Programm ist und den Nagulendran-Lehrstuhls für Friedensmediation innehat.
Alle Publikationen des Geneva Policy Outlook 2024 sind persönliche Beiträge der Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten der Institutionen wider, die sie vertreten, noch die Ansichten der Republik und des Staates Genf, der Stadt Genf, der Fondation pour Genève und des Geneva Graduate Institute.