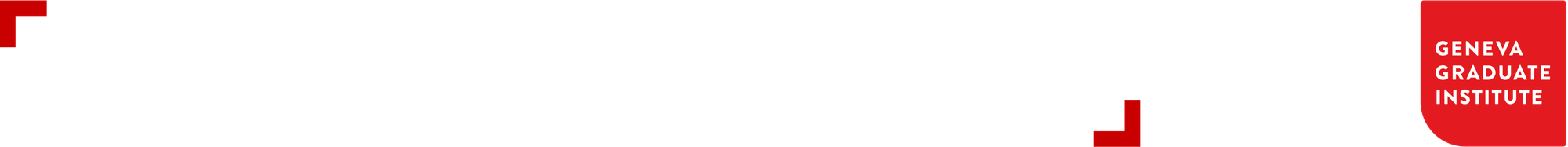Solomon Dersso
Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass sich das multilaterale System in einer tiefen Krise befindet. Zum einen ist die kurze unipolare Phase nach dem Kalten Krieg, die drei Jahrzehnte lang die multilaterale Zusammenarbeit geprägt hat, zu Ende gegangen. Wir befinden uns im Übergang zu „eine neuen Weltordnung“, nämlich einer multipolaren Ordnung, wie es UN-Generalsekretär António Guterres ausgedrückt. In seiner Neuen Agenda für den Frieden beschreibt er ein Hauptmerkmal dieses Moments: „Die Machtdynamiken zerfallen zunehmend, während neue Einflusspole entstehen, sich neue Wirtschaftsblöcke sich formieren und die Achsen der Kontroversen neu definiert werden.“ Er weist auch auf einen „Vertrauensverlust zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden“ hin.
Zum anderen steht die Welt vor sogenannten Polykrisen – mehreren und sich überlagernden Krisen wie Klimakatastrophen, Pandemien sowie Armut und Ungleichheit, die ein kollektives Handeln aller Regionen erfordern.
Diese Veränderung und Herausforderungen haben die Global Governance an einen wichtigen Scheideweg gebracht. Wieder einmal steht das multilaterale System vor einer harten Entscheidung, oder, um es mit den Worten Guterres auszudrücken: „Reform oder Bruch“. Laut einem Bericht eines hochrangigen Expertengremiums über Afrika und die Reform des multilateralen Systems ist für den Großteil der Welt die Reform die einzige Wahl.
Eine afrikanische Perspektive auf die aktuelle Global Governance
Die Art und Weise, wie Global Governance organisiert und betrieben wird, war sie nie wirklich global, sondern schon immer auf die Länder des Nordens ausgerichtet.
Ein wesentlicher Aspekt der Reformagenda besteht darin, die Organisationsstruktur der Global Governance und ihre Funktionsweise zu überdenken. Die Art und Weise, wie Global Governance organisiert und betrieben wird, war sie nie wirklich global, sondern schon immer auf die Länder des Nordens ausgerichtet. Schaut man sich dann an, wo die Weltordnungspolitik angesiedelt ist, so findet man viele Institutionen der Weltordnungspolitik im globalen Norden, vor allem in Europa und den USA. Eines dieser Zentren von Global Governance ist Genf, wo die UN-Menschenrechtsorganisation, die Welthandelsorganisation und andere UN-Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation angesiedelt sind.
Ein zentrales Reformfeld ist die Stärkung der Repräsentativität von Global-Governance-Institutionen, um die Defizite in der gegenwärtigen Ausgestaltung von Global Governance anzugehen. Dies geschieht durch die Besetzung von Sitzen in den Entscheidungsgremien von Institutionen wie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNO).
Ein weiterer Reformbereich betrifft die Funktionsweise des multilateralen Systems, wie die Debatten über den Covid-19-Impfstoff und die internationale Reaktion auf Gräueltaten in verschiedenen Konfliktsituationen gezeigt haben. In der Generalversammlung der UNO, die in den Debatten über die Weltpolitik wieder an Bedeutung gewonnen hat, nutzte der globale Süden die Zahl seiner Länder, um zu zeigen, was Inklusivität bedeutet. Ein Beispiel dafür war, als Afrika die Welt dazu brachte, einen Beschluss der UN-Generalversammlung zur Ausarbeitung einer UN-Konvention über die Zusammenarbeit in Steuerfragen zu verabschieden.
Abgesehen von der Steuerkonvention haben die afrikanischen Mitgliedstaaten der UN-Mitgliedsstaaten, die rund 28 Prozent der UN-Mitgliedsstaaten ausmachen, zusammen mit den anderen Ländern des globalen Südens unter dem Dach der G77 plus China die Anzahl ihrer Länder bei den Verhandlungen über den Zukunftspakt zu ihrem Vorteil genutzt. Neben ihren Zugeständnissen bei der Reform der globalen Finanzinstitutionen gewährten, spielten die afrikanischen Staaten eine führende Rolle bei der Vereitelung des russischen Manövers, den Konsens über den Zukunftspakt am Ende des Verhandlungsprozesses zu Fall zu bringen. Der im Namen aller afrikanischen UN-Mitgliedsstaaten eingebrachte Antrag Kongos, nicht über die von Russland vorgeschlagenen Änderungen abzustimmen, trug den Sieg davon und sicherte die Verabschiedung des Paktes als Konsensbeschluss.
Auch an anderen politischen Schauplätzen und diplomatischen Drehscheiben nutzen die afrikanischen Länder ihre zahlenmäßige Stärke aus. Ein Paradebeispiel dafür ist Genf.
Von besonderem Interesse als Weg zu einer effizienten und wirklich globalen Global Governance ist neben den oben diskutierten Reformen die Auseinandersetzung mit Guterres‘ Vorschlag eines vernetzten Multilateralismus, bei dem „die UN-Familie, die internationalen Finanzinstitutionen, regionale Organisationen, Handelsblöcke und andere enger und effizienter zusammenarbeiten.“
Die Afrikanische Union im Zeitalter des vernetzten Multilateralismus
Ein wichtiger Aspekt des vernetzten Multilateralismus ist laut Guterres darin, die Aufwertung und systematische Einbindung regionaler Organisationen, insbesondere der Afrikanischen Union (AU), aufzuwerten und diese systematisch einzubinden. In Unsere gemeinsame Agenda sagte Guterres, dass regionale Organisationen „von zentraler Bedeutung sind, wenn es darum geht, den Frieden zu sichern und unsichere Lagen zu verhindern und darauf zu reagieren“ und sie eine „wichtige Lücke in unserer Weltfriedens- und Sicherheitsstruktur füllen“.
Damit wird auch anerkannt, dass die Einbeziehung regionaler Organisationen ein sinnvolles Mittel ist, um die Global Governance wirklich global zu machen und damit die nordorientierte Prägung abzuschwächen. Dies setzt voraus, dass sich regionale Organisationen, insbesondere die aus dem Globalen Süden, systematisch und nicht nur ad hoc einbeziehen.
Ein gutes Beispiel für eine solche regionale Organisation ist die AU. Sie hat ihren Sitz in Addis Abeba, Äthiopien, das sich selbst als eine der wichtigsten diplomatischen Drehscheiben der Welt bezeichnet. Neben der AU haben 134 Botschaften und Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika ihren Sitz in Addis Abeba.
In den letzten zwei Jahrzehnten und zunehmend auch in den letzten Jahren hat sich die AU zu einer wichtigen Plattform für die Gestaltung und Einflussnahme auf die Weltordnungspolitik entwickelt.
In den letzten zwei Jahrzehnten und zunehmend auch in den letzten Jahren hat sich die AU zu einer wichtigen Plattform für die Gestaltung und Einflussnahme auf die Weltordnungspolitik entwickelt. Dies zeigt sich in der Art und Weise, wie sie die kollektive Stimme ihrer Mitgliedstaaten zur Verbesserung des Gemeinwohls auf der ganzen Welt genutzt hat. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie wurde die AU zum Vorbild für einen funktionierenden effektiven Multilateralismusin einer Zeit, in der sich viele Länder, insbesondere im globalen Norden, stärker auf sich selbst konzentrieren. Die Rolle der AU bei der Förderung von Frieden und Sicherheit auf internationaler Ebene wird weithin anerkannt. Die jüngste Aufnahme der AU in die G20 spiegelt die wachsende Rolle der AU in den Bereichen Wirtschaft und Entwicklung der Global Governance wider.
Addis Abeba und Genf verbinden
Es ist inzwischen weithin anerkannt, dass Global Governance nicht so nordzentriert bleiben kann, wie sie es ist, weder geographisch noch im übertragenen Sinne. Zum vernetzten Multilateralismus gehört auch, sich die Rolle der AU zu nutzen und ihre Mitglieder durch den politischen Austausch und Kooperation zwischen Addis Abeba und Genf als wichtigen Stimmblock in der UNO zu nutzen. Dieser Ansatz ist vielversprechend, um Global Governance wieder wirklich global zu machen und damit fit für alle Veränderungen und Herausforderungen dieser sich herausbildenden multipolaren Ordnung.
Eine Möglichkeit, um diesen vernetzten Multilateralismus zu verfolgen, besteht darin, enge Arbeitsbeziehungen zwischen den Zentren der Global Governance, wie zum Beispiel Genf und Addis Abeba aufzubauen und zu pflegen. Dies kann unter anderem durch die Förderung des politischen Dialogs zwischen den beiden diplomatischen Knotenpunkten zu verschiedenen politischen Themen von weltweiter Bedeutung geschehen. Bereiche für eine engere Zusammenarbeit könnten beispielsweise sein:
- Angesichts der Rolle der AU im Bereich Frieden und Sicherheit kann ein friedens- und sicherheitsförderndes kollektives Handeln durch eine enge Abstimmung zwischen Addis Abeba und Genf weiter verbessert werden. Dies könnte zumindest dazu beitragen, den Widerstands der afrikanischen Gruppe gegen Initiativen des UN-Menschenrechtsrats zu menschenrechtlichen Aspekten von Konflikten zu verringern.
- Ausgehend von der Arbeitsgruppe Konflikte und Menschenrechte lautet das Thema der AU für das Jahr 2025 „Gerechtigkeit für Menschen in Afrika und afrikanischer Abstammung durch Wiedergutmachung“. Dies ist eine weitere gute Gelegenheit, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Knotenpunkten zu fördern. Im Protokoll betonten sowohl Guterres als auch Volker Türk, dass zur Bewältigung des Erbes von Sklaverei und Kolonialismus, das sich bis heute negativ auf das tägliche Leben der Betroffenen auswirkt, wiedergutmachende Gerechtigkeit oberste Priorität haben müsse.
- Ein dritter Bereich für eine enge politische Abstimmung zwischen den beiden Knotenpunkten sind die laufende Bemühungen der AU, die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AfCFTA) zu operationalisieren, die für die in Genf ansässige WTO von großem Interesse ist. Dies wird auch dazu beitragen, die Frage zu beantworten, welche Rolle die AfCFTA bei der Förderung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung spielen kann.
2025 könnte ein Jahr werden, in dem verschiedene Wege des Austauschs zwischen Addis Abeba und Genf erprobt werden, um mit Blick auf die Zukunft einen stärker vernetzten Multilateralismus zu knüpfen.
So könnte 2025 ein Jahr werden, in dem verschiedene Wege des Austauschs zwischen Addis Abeba und Genf erprobt werden, um mit Blick auf die Zukunft einen stärker vernetzten Multilateralismus zu knüpfen.
Über den Autor
Solomon Dersso ist Gründungsdirektor von Amani Africa, einer unabhängigen, panafrikanischen Denkfabrik für die politische Forschung, Schulung und Beratung.
Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die der Autoren. Sie geben nicht vor, die Meinungen oder Ansichten des Geneva Policy Outlook oder seiner Partnerorganisationen wiederzugeben.