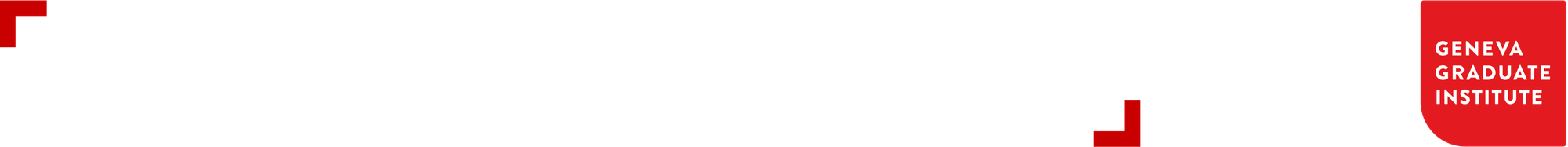Aditya Bharadwaj
Die Fruchtbarkeit der Menschen nimmt weltweit stetig ab, was in wissenschaftlichen und politischen Kreisen zu wachsender Besorgnis führt. Neben den hinreichend bekannten Faktoren wie hormonelles Ungleichgewicht, Umweltschadstoffen und veränderten Lebensgewohnheiten ist jetzt ein relativ neues und akutes Problem hinzugekommen: Mikroplastik. Diese winzigen, weniger als 5 mm großen Kunststoffpartikel verbreiten sich in sämtlichen Ökosystemen aus und wurden bereits im menschlichen Körper nachgewiesen, unter anderem im Blut, in der Plazenta und in den Fortpflanzungsorganen. Es gibt Hinweise darauf, dass Mikroplastik einen erheblichen Einfluss auf die menschliche Fruchtbarkeit haben könnte, was wiederum Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die sozioökonomische Stabilität haben könnte.
Mikroplastik und reproduktive Gesundheit: Winzige Partikel, große Folgen
Mikroplastik entsteht durch den Zerfall größerer Kunststoffobjekte und die absichtliche Herstellung von Mikroperlen für industrielle Zwecke. Diese winzigen angefertigten Partikel werden für die Herstellung von Alltagsprodukten verwendet, von Kosmetika bis hin zu medizinischen Anwendungen. Sie gelangen über den Mund, die Atmung oder die Haut in den menschlichen Körper. Aufgrund ihrer geringen Größe können sie Zellmembranen durchdringen und sich im Gewebe ansammeln. Zusätzlich zu ihrer physischen Präsenz werden die Auswirkungen von Mikroplastik durch endokrine Disruptoren (ED) verstärkt, denen wir durch unseren Lebensstil ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Bisphenol A (BPA) und Phthalate, die die Aktivität von Hormonen imitieren oder in den Hormonhaushalt eingreifen. Untersuchungen zu den Auswirkungen von Mikroplastik auf die Fruchtbarkeit im Tiermodell zeigten beunruhigende Tendenzen. So zeigen weibliche Mäuse, die Mikroplastik ausgesetzt waren, eine verminderte Eierstockfunktion, mit gestörten Menstruationszyklen und Beeinträchtigungen bei der Embryo-Einnistung auf. Forschungen zur männlichen Fortpflanzungsfähigkeit haben eine verminderte Spermienqualität, einschließlich verminderter Motilität und Konzentration, sowie erhöhte DNA-Schäden ergeben. Obwohl es bisher nur wenige Studien gibt, die sich direkt mit dem Menschen befassen, deuten diese Ergebnisse auf die Möglichkeit erheblicher Reproduktion Schäden hin.
Sinkende Fruchtbarkeitsraten und Mikroplastik: Eine übersehene Überschneidung
Die Fruchtbarkeitsraten gehen weltweit rapide zurück. Betrug die weltweite durchschnittliche Geburtenrate 1960 noch 5 Kinder pro Frau, so sank sie bis 2020 auf 2,3 Kinder pro Frau. Dieser Rückgang wird vor allem auf sozioökonomische Faktoren wie späte Mutterschaft, finanziellen Druck und besseren Zugang zu Verhütungsmitteln zurückgeführt. Nicht zu vernachlässigen ist die Rolle von Umwelteinflüssen, darunter Mikroplastik, bei der zunehmenden Unfruchtbarkeit.
Das weit verbreitete Vorkommen von Mikroplastik in Lebensmitteln, Wasser und Luft unterstreicht, wie schwierig es ist, den Kontakt damit zu vermeiden.
Die Entdeckung von Mikroplastik in der menschlichen Plazenta weist auf einen wichtigen Übertragungsweg hin, über den diese Partikel die Entwicklung des Fötus und die Gesundheit der Mutter beeinträchtigen könnten. Mikroplastik wurde in der Plazenta von Frauen mit normaler Schwangerschaft gefunden. Dies führte zu Bedenken über mögliche Auswirkungen von Mikroplastik auf das embryonale Wachstum und die Entwicklung des kindlichen Immunsystems. Darüber hinaus unterstreicht das weit verbreitete Vorkommen von Mikroplastik in Lebensmitteln, Wasser und Luft, wie schwierig es ist, den Kontakt damit zu vermeiden. Doch trotz zunehmender Hinweise ist der Zusammenhang zwischen Mikroplastik und Fruchtbarkeit sowohl in wissenschaftlichen Studien als auch im politischen Kontext noch wenig erforscht. Politische Maßnahmen und Organisationen, die sich mit Fertilität befassen, konzentrieren sich traditionell auf sozioökonomische und medizinische Interventionen, wie die Verbesserung des Zugangs zu Fertilitätsbehandlungen oder die Berücksichtigung von Lebensstilfaktoren.
Inzwischen konzentrieren sich politische Initiativen zu Mikroplastik auf die Umweltbelastung und Strategien zur Abfallvermeidung und -beseitigung und vernachlässigen dabei oft die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Diese Zweiteilung schafft einen gefährlichen blinden Fleck, der eine effektive Politikgestaltung behindert. So werden zum Beispiel Fruchtbarkeit oder Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit nur selten in internationale politische Rahmenwerke zur Mikroplastik integriert, wie zum Beispiel in Resolutionen der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA). Der Mangel an ganzheitlichen Ansätzen bedeutet, dass keine der beiden Gruppen ausreichend vorbereitet ist, um die Überschneidungen zwischen den beiden Themen anzugehen.
Forschungslücken schließen
Die oben genannten Punkte unterstreichen die Dringlichkeit, bestimmte Forschungsbereiche zu priorisieren. Obwohl immer mehr Forschungsarbeiten einen Zusammenhang zwischen Mikroplastik und Unfruchtbarkeit herstellen und neue Erkenntnisse über die Schädigungsfolge - oxidativer Stress, Entzündungen und endokrine Disruption - vorliegen, werden dringend Folgestudien am Menschen benötigt, um die Hinweise aus Tierversuchen zu bestätigen und die Risiken zu quantifizieren. Das wachsende öffentliche Bewusstsein für Mikroplastik bietet eine gute Gelegenheit für Lobbyarbeit. Ebenso können Kampagnen dieses Bewusstsein nutzen, um die potenziellen Risiken für die Fruchtbarkeit hervorzuheben und damit die Forderung nach stärkeren regulatorischen Maßnahmen voranzutreiben. Zunehmende Fortschritte in der Analysetechnologie, wie Spektrometrie und Mikroskopie, ermöglichen einen genaueren Nachweis und eine genauere Typisierung von Mikroplastik, was sich als entscheidend für die Einstufung des Expositions Grades und deren Korrelation mit Fruchtbarkeitsergebnissen erweisen könnte. Mit anderen Worten: Um diese Wissenslücken zu schließen, sind verstärkte Forschungsinitiativen erforderlich. Langzeitstudien zu den Auswirkungen von Mikroplastik auf die menschliche Fertilität müssen in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Biologie und einer Reihe von Sozialwissenschaften oberste Priorität haben. Groß angelegte epidemiologische Studien und innovative Laborforschung könnten durch die Förderung von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) unterstützt werden. Darüber hinaus könnten Partnerschaften zwischen Universitäten und der Industrie die Entwicklung von biologisch abbaubaren Materialien fördern, die die zukünftige Umweltverschmutzung durch Mikroplastik verringern könnten.
Genfs Rolle als Brücke zwischen Mikroplastik und Fertilitäts Politik: Ein Aufruf zum Handeln
Als Knotenpunkt der internationalen Politik ist Genf in einer guten Position, um ein koordiniertes Vorgehen zu fördern. So könnte beispielsweise eine UNEA-Resolution 2025 Mikroplastik explizit mit der menschlichen Gesundheit in Verbindung bringen, Studien zu den Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit in Auftrag geben und strengere Grenzwerte für hormonaktive Substanzen fordern. Organisationen, die sich mit Fruchtbarkeit befassen, wie die European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) (europäische Gesellschaft für menschliche Fortpflanzung und Embryologie) oder die American Society for Reproductive Medicine (ASRM) (amerikanische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin), sollten mit den Vereinten Nationen und internationalen Umweltbehörden zusammenarbeiten, um die Gefahren von Mikroplastik in die Agenda für reproduktive Gesundheit aufzunehmen. Darüber hinaus sollten öffentliche Gesundheitskampagnen in leicht verständlichen Worten auf die Risiken von Mikroplastik für die Fortpflanzungsfähigkeit aufmerksam machen und die neuen Erkenntnisse sollten Gesundheitsfachkräften in ihrer Ausbildung vermittelt werden, damit sie später in der Praxis ihre Patientinnen und Patienten anleiten können, die Exposition zu minimieren. Schulen und Universitäten könnten das Thema in ihre Lehrpläne aufnehmen, um es langfristig im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern.
Darüber hinaus könnten politische Entscheidungsträger durch Steuervergünstigungen oder Subventionen Anreize für die Entwicklung nachhaltiger Materialien und Technologien zur Filterung von Mikroplastik schaffen. Subventionen für Innovationen in der Abwasserbehandlung könnten beispielsweise den Eintrag von Mikroplastik in die Wasserversorgung reduzieren und damit indirekt zu einer geringeren Exposition der Menschen beitragen. Unmittelbare Vorteile könnten durch die Beschleunigung von Maßnahmen erzielt werden, die bereits schrittweise umgesetzt werden, wie die schrittweise Reduzierung von Einweg-Kunststoffen oder das Verbot bestimmter Produkte, die Mikroplastik enthalten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, nationale Regelungen mit internationalen und multilateralen Übereinkommen in Einklang zu bringen, um einen kohärenten Ansatz zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Mikroplastik zu fördern.
Bis 2025 werden interdisziplinäre Ansätze, bei denen Biologie und Sozialwissenschaften zusammenarbeiten, solide Forschungsinitiativen und mutige politische Entscheidungen entscheidend sein, um dieses Risiko zu verringern.
Auch wenn die Beweise für einen Zusammenhang zwischen Mikroplastik und menschlicher Fruchtbarkeit noch weiter verfeinert werden müssen, sind sie bereits stark genug, um die sofortige Aufmerksamkeit von Forschung und Politik zu rechtfertigen. Wenn es nicht gelingt, eine Brücke zwischen den politischen Lagern für Mikroplastik und Fruchtbarkeit zu schlagen, wird die Menschheit schlecht gerüstet sein, um dieser wachsenden Bedrohung zu begegnen. Bis 2025 werden interdisziplinäre Ansätze, bei denen Biologie und Sozialwissenschaften zusammenarbeiten, solide Forschungsinitiativen und mutige politische Entscheidungen entscheidend sein, um dieses Risiko zu verringern. Als internationale politische Drehscheibe könnte Genf eine Vorreiterrolle übernehmen, indem es den Dialog fördert, ganzheitliche politische Richtlinien entwickelt und zu globalem Handeln aufruft. Es scheint, dass es uns zu teuer kommt, nichts zu tun.
Über den Autor
Aditya Bharadwaj ist Professor und Lehrstuhlinhaber für Anthropologie und Soziologie am Geneva Graduate Institute, dem er als stellvertretender Leiter des Gender Centre (Zentrum für Geschlechterforschung) vorsteht.
Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die der Autoren. Sie geben nicht vor, die Meinungen oder Ansichten des Geneva Policy Outlook oder seiner Partnerorganisationen wiederzugeben.