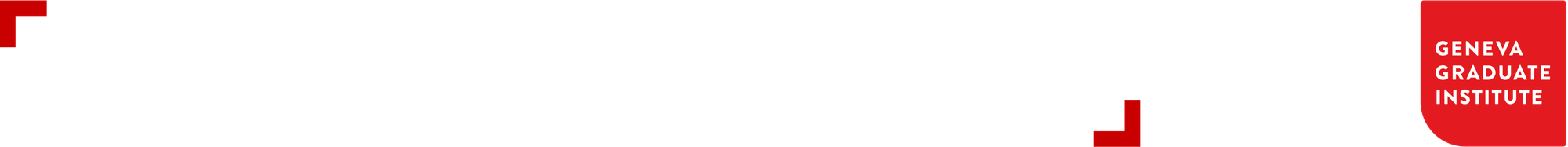Heba Aly
Genf rühmt sich, eine Hauptstadt des Multilateralismus zu sein. Und doch drehen sich die meisten Diskussionen hier um den Niedergang des Multilateralismus. Es ist an der Zeit, ein paar Lösungen vorzuschlagen.
Die Geburtsstunde des heutigen Multilateralismus – in Form der Charta der Vereinten Nationen (UNO) – schlug 1945. Stephen Heintz schreibt, dass die „Logik“ der internationalen Beziehungen damals auf der Überlegenheit der Macht, dem Primat nationaler Interessen, und auf Imperialismus, Rassismus und Patriarchat beruhte. Die Welt war aufgeteilt in „die Guten“ und „die Bösen“ (in der Charta als „Feindstaaten“ bezeichnet) sowie in Mächtige und Machtlose (eines der durch die Charta geschaffenen Organe der UNO ist der Treuhandrat, der den Auftrag hatte, den Übergang der Kolonialgebiete in die Unabhängigkeit überwachen sollte).
Damit der Multilateralismus seinen Zweck besser erfüllen kann, besteht eine Lösung darin, seinen Gründungsvertrag - die Charta der UNO - anzupassen.
Die Charta der UNO ist eines der wenigen Dokumente, die heute universelle Anerkennung genießen. In einer Zeit der geopolitischen Zersplitterung und Polarisierung ist dies von großer Bedeutung.
Sie war jedoch nicht immer als lebendiges Dokument gedacht.
Die Charta als lebendiges Dokument
Auf der internationalen Konferenz in San Francisco, auf der die Charta der UNO verabschiedet wurde, sagte US-Präsident Harry Truman: „Diese Charta ... wird im Laufe der Zeit erweitert und verbessert werden. Niemand behauptet, dass sie schon jetzt ein endgültiges oder gar perfektes Instrument darstellt. Sie wurde nicht in feste Formen gegossen. Wenn sich die Verhältnisse auf der Welt ändern, muss sie entsprechend angepasst werden.“
Fast 80 Jahre später sind diese Anpassungen längst überfällig.
Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva lädierte in einer eindringlichen Rede vor der UNO-Generalversammlung im September 2024 für eine Reform der UN-Charta: „Die aktuelle Version der Charta befasst sich nicht mit einigen der dringendsten Herausforderungen der Menschheit.“
Die Hauptaufgabe der UNO ist es, Frieden und Sicherheit zu gewährleisten, aber die Unfähigkeit, Kriege in der Ukraine, im Gazastreifen, im Sudan und an vielen anderen Orten zu verhindern, zeigt deutlich, dass unser globales Sicherheitssystem gescheitert ist.
Darüber hinaus sieht die Charta in einem dritten Weltkrieg die größte Bedrohung für die Menschheit. Diese Gefahr besteht natürlich nach wie vor, aber auch die existenzielle Bedrohung durch den planetarischen Notstand und die ungehinderte Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die im Text von 1945 nicht erwähnt werden.
Zudem wurde die Charta ursprünglich nur von 50 Ländern angenommen - der Großteil des afrikanischen Kontinents stand damals noch unter Kolonialherrschaft und erlangte erst in den 1950er und 60er Jahren seine Unabhängigkeit. Heute gibt es 193 souveräne Staaten auf der Welt.
Die Charta stellt die Nationalstaaten als diejenigen Akteure des Multilateralismus in den Mittelpunkt, während heute Bürger, der Privatsektor und andere Akteure immer wichtigere Rolle spielen.
Die Macht liegt fest in den Händen der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats (P5), darunter Großbritannien und Frankreich – zwei Länder, die heute weit weniger Macht haben, als beispielsweise Indien, Deutschland, Japan oder Brasilien. Die Charta stellt die Nationalstaaten als diejenigen Akteure des Multilateralismus in den Mittelpunkt, während heute Bürger, der Privatsektor und andere Akteure immer wichtigere Rolle spielen.
Artikel 109: Eine Konferenz zur Überarbeitung der Charta?
Welche Mechanismen müssen also verändert werden?
Ein Mechanismus hat seine Wurzeln UNO-Charta selbst.
1945 lehnte eine Mehrheit der Unterzeichnerstaaten das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ab. Wie Mahmoud Sharei ausführlich darlegt, einigten sie sich dennoch auf die Unterzeichnung der Charta mit dem „Versprechen einer demokratischen UNO in der Zukunft“.
Diese „Annahme unter Vorbehalt“, wie Sharei es nennt, manifestierte sich in Artikel 109 der Charta, der eine Generalkonferenz zur Revision der Charta innerhalb von zehn Jahren nach Gründung der UNO vorsah.
Dieses Versprechen wurde nie eingelöst.
Der Gedanke, diese wichtigste aller Verfassungen heute neu zu schreiben, mag befremdlich erscheinen, aber ein Blick auf die Vorschläge des Global Governance Forum (Forum für Weltordnungspolitik), wie eine „Zweite Charta“ aussehen könnte, macht deutlich, dass es mehr zu gewinnen als zu verlieren gibt.
Eine zweite Charter könnte dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, in der die Macht gerechter verteilt ist, in der die Klimakrise und andere aufkommende Bedrohungen besser angegangen werden, in der unsere gegenseitige Abhängigkeit anerkannt wird, und in der die UNO durch die Einrichtung eines Weltparlaments demokratischer wird.
Vieles von dem, was in der aktuellen Charta steht, sollte erhalten bleiben. Dennoch könnte eine Überarbeitung dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, in der die Macht gerechter verteilt ist, in der die Klimakrise und andere aufkommende Bedrohungen besser angegangen werden, in der unsere gegenseitige Abhängigkeit anerkannt wird, in der die UNO durch die Einrichtung eines Weltparlaments - ähnlich dem Europäischen Parlament - demokratischer wird und in der „Wir, die Völker“ - und nicht die Staaten – im Mittelpunkt der Weltordnungspolitik stehen. Obwohl es berechtigte Befürchtungen gibt, dass dadurch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, bietet die Funktionsweise von Artikel 109 einen fehlersicheren Mechanismus gegen einen Rückschritt, da die Charta von einer Mehrheit der Regierungen und den P5 ratifiziert werden muss, um in Kraft zu treten (hier finden Sie weitere Antworten auf die üblichen Bedenken gegen die Reform der Charta).
Im Vorfeld des UNO-Zukunftsgipfels im September 2024 hat die seit langem andauernde Bewegung zur Reform der Charta neuen Schwung erhalten und alle Staaten haben eine Reihe von Verpflichtungserklärungen zur Erneuerung des Multilateralismus verabschiedet.
Diese Idee wird von Brasilien, ehemalige Staatsoberhäuptern, Diplomaten und Nobelpreisträgem unterstützt, angefangen bei der Journalistin Maria Ressa und dem ehemaligen Präsidenten von Costa Rica Jose Maria Figueres, über den ehemaligen kenianischen UN-Botschafter Martin Kimani und den Chefberater und geschäftsführenden Regierungschef der von Bangladesch, Mohammad Yunus bis hin zum Hochrangigen Beirat des UN-Generalsekretärs für effektiven Multilateralismus, der sich in seinem wegweisenden Bericht auf Artikel 109 berief.
Diese Idee wird von Brasilien, Koalition für die Reform der UN-Charta mobilisiert nun die Mitgliedsstaaten, um eine Generalkonferenz zur Revision der UN-Charta einzuberufen. Ziel ist es, bis 2025 mehr als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen und sechs unterstützende Mitgliedstaaten zu gewinnen.
Auch wenn diese Bestrebungen auf zahlreiche Hindernisse stoßen, so ist doch angesichts der vielen Regionen der Welt, denen die gegenwärtige Weltordnung keine guten Dienste leistet, ist ein neues System der Weltordnungspolitik unumgänglich.
„Ich mache mir keine Illusionen“, bekannte Präsident Lula in seiner Rede, „wie komplex so eine Reform wie diese sein wird. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass sich dabei ein Interesse an der Bewahrung des Status quo herauskristallisieren wird und umfangreiche Verhandlungen erforderlich sein werden. Doch dafür sind wir zuständig.“
Lula fuhr fort: „Wir können nicht auf eine weitere weltumspannende Tragödie wie den Zweiten Weltkrieg warten, um erst dann auf deren Trümmern eine neue Weltordnung aufzubauen.“
Für alle, die in der internationalen Architektur in Machtpositionen innehaben, gibt es zudem einen sehr viel konkreten Anreiz, sich für die Reform einzusetzen. Sie haben ein Interesse daran, die Machtverteilung in der UNO-Charta jetzt neu zu verhandeln, solange sie noch über einen relativen Machtvorteil verfügen. Verschiebungen im realen Machtgefüge sind bereits im Gange und diese werden durch die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA wahrscheinlich noch beschleunigt. In den nächsten 10 bis 20 Jahren könnten neue Mächte einfach ihre eigenen Machtorgane bilden oder zumindest eine stärkere Verhandlungsposition einnehmen.
Welche Rolle soll Genf übernehmen?
Der Gesamtbeitrag der Schweiz an die UNO belief sich 2023 auf 805 Millionen US-Dollar, die Schweiz auf dem 13. Platz der Beitragszahlungen in der Organisation steht. Angesichts dieser großen Investition hat die Schweiz ein wirtschaftliches Interesse an einer effizienten UNO.
Insbesondere die Tatsache, dass in Genf haben ein UNO-Hauptquartier, 181 staatliche und 40 internationale Organisationen (darunter UN-Sonderorganisationen wie der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Und die Weltgesundheitsorganisation) sowie 461 Nichtregierungsorganisationen ihren Sitz haben, bietet einen fruchtbaren Boden für eine Debatte über die Grundlagen der künftigen internationalen Beziehungen unter Beteiligung aller Interessengruppen.
Als Heimat der Menschenrechte, der humanitären Hilfe und der globalen Gesundheitspolitik sind die Akteure in Genf mit den Folgen eines Scheiterns der Global Governance in der Praxis besser vertraut als in New York.
Im Vergleich zum UNO-Hauptquartier in New York ist das weniger politisierte Umfeld in Genf ideal, um mutige Ideen für die Zukunft des Multilateralismus zu entwickeln. Als Heimat der Menschenrechte, der humanitären Hilfe und der globalen Gesundheitspolitik sind die Akteure in Genf mit den Folgen eines Scheiterns der Global Governance in der Praxis besser vertraut als in New York. Vielleicht hat man deshalb den Eindruck, dass die Botschafterinnen und Botschafter hier eher bereit sind, dem kollektiven als dem nationalen Interesse zu dienen.
Früher oder später muss die Charta der UNO entscheidend verbessert werden. Die historische Neutralität der Schweiz und das internationale Mosaik von Genf erlauben es der Schweiz und dem daraus entstandenen Genfer internationalen Ökosystem,eine führende Rolle zu spielen, wenn es darum geht, diesem wichtigsten aller Dokumente neues Leben einzuhauchen.
Über den Autor
Heba Aly ist Koordinatorin der Koalition für die Reform der UN-Charta, leitende Beraterin der Coalition for the UN We Need und ehemalige Geschäftsführerin von The New Humanitarian.
Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die der Autoren. Sie geben nicht vor, die Meinungen oder Ansichten des Geneva Policy Outlook oder seiner Partnerorganisationen wiederzugeben.