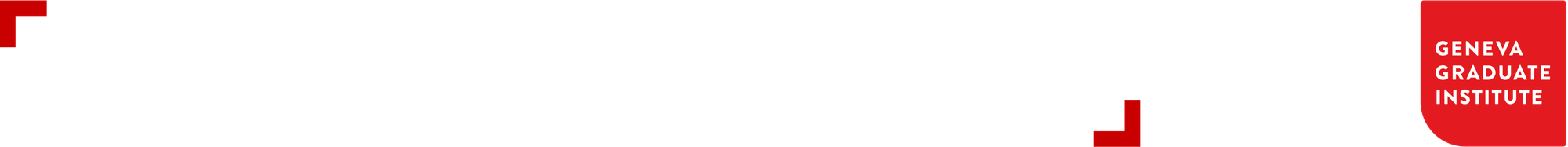Richard Gowan
Bei den diesjährigen Gesprächen über den Zukunftspakt waren die Verhandlungspartner oft besorgt darüber, dass der Abschnitt über Frieden und Sicherheit im Text auffallend kurz ausfiel. Als Generalsekretär Guterres 2021 den Prozess für den Zukunftsgipfel 2021 einleitete, spielte er die Sorgen um die internationale Sicherheit herunter und legte den Schwerpunkt stattdessen mehr auf Technologie und Wirtschaft. Nach der russischen Aggression in der Ukraine hielten es die Diplomatinnen und Diplomaten durchaus für wichtig, dass sich der Pakt sich auch mit Sicherheitsfragen befasst. Doch kaum jemand sah in diesem Bereich viele konsensfähige Themen.
Der Zukunftspakt bietet dem UNO-Sekretariat und den Mitgliedstaaten eine nützliche Auswahl an Optionen für eine bessere Zusammenarbeit an die Hand.
Gemessen an diesen geringen Ambitionen hat der Pakt die Erwartungen übertroffen. Kapitel 2 des Dokuments enthält eine angemessene – wenn auch wenig originelle - Reihe von Prioritäten zur Stärkung des Krisenmanagements der Vereinten Nationen (UNO) und zur Förderung der Abrüstung. Kapitel 5 geht unerwartet ausführlich auf die Notwendigkeit einer Reform des Sicherheitsrats ein. Positiv erwähnt werden die Rollen der Kommission für Friedenskonsolidierung und der Generalversammlung in Friedens- und Sicherheitsfragen. Auch wenn der Pakt keine bahnbrechenden Konzepte zur Aufrechterhaltung der internationalen Sicherheit enthält, bietet er der UNO-Sekretariat und den Mitgliedstaaten eine nützliche Auswahl an Optionen für eine bessere Zusammenarbeit an die Hand.
Ein Pakt im Kontext einer sich wandelnden internationalen Ordnung
Die meisten dieser Optionen beziehen sich auf bereits bestehende Mechanismen und Prozesse der UNO und fordern die Staaten auf, diese zu beschleunigen. Maßnahme 21 enthält eine Aufforderung an den Generalsekretär, eine „Überprüfung aller Formen von UNO-Friedensmissionen“ durchzuführen. Dies reflektiert den wachsenden Eindruck in der New Yorker Diplomatie, dass die UNO die Stärken von Blauhelm-Friedensmissionen und politischen Sondermissionen in letzter Zeit unterbewertet hat. Die Maßnahmen 18 und 44 empfehlen Schritte zur Stärkung der UNO-Friedenskonsolidierungsarchitektur. Dies kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn 2025 wollen die Mitgliedsstaaten die Arbeit der Kommission für Friedenskonsolidierung und die damit verbundenen Mechanismen überprüfen. Die Formulierungen im Pakt zu Themen wie Frauen, Abrüstung und der Friedens- und Sicherheitsagenda machen deutlich, wie wichtig die bestehenden Verpflichtungserklärungen der Staaten sind.
Dies bedeutet nicht, dass der Pakt völlig rückwärtsgewandt ist. Maßnahme 22 ist eine suggestive – wenn auch unspezifische – Aufforderung zu mehr internationaler Zusammenarbeit im Bereich der maritimen Sicherheit. Sie stellt zwar keinen Präzedenzfall dar (der Sicherheitsrat hat sich z. B. bereits mit der Piraterie am Horn von Afrika und im Golf von Guinea befasst), könnte aber nach den Krisen im Schwarzen und Roten Meer den Ausgangspunkt für neue Initiativen bilden. Maßnahme 27 schöpft (wenn auch zögerlich) alle Möglichkeiten aus, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, die sicherheitspolitischen Implikationen neuer Technologien, insbesondere die Gefahren eines Wettrüstens im Weltraum, stärker zu berücksichtigen.
Was bedeutet der Zukunftspakt für das Internationale Genf?
Für die humanitären Organisationen in Genf liest sich der Text so, als enthalte er nützliches Material über die Notwendigkeit, den Schutz der Zivilbevölkerung in Konflikten für zu gewährleisten (Maßnahme 14) und besser auf humanitäre Notsituationen zu reagieren (Maßnahme 15). Beide Abschnitte beschränken sich jedoch Wesentlich darauf, die bestehenden internationalen Verpflichtungen in diesen Bereichen zu wiederholen, ohne konkrete Vorschläge zu machen, wie man staatliche und nichtstaatliche Truppen dazu gebracht werden können, das humanitäre Völkerrecht und internationale Standards zu respektieren. Maßnahme 15 erkennt zwar an, dass mehr Mittel für die humanitäre Hilfe bereitgestellt werden müssen, gibt aber keine Anleitung, wie diese Mittel bereitgestellt werden sollen. Somit ist der Pakt für die humanitären Hilfsorganisationen zwar ein nützliches Instrument für humanitäre Hilfsorganisationen, um ihre Schwierigkeiten zu benennen, aber kein strategischer Plan zu deren Überwindung.
Der Pakt bietet den Menschenrechtsexperten auch einige vereinzelte Öffnungen, die einen grundrechtlich basierten Ansatz in der Konfliktprävention und -bewältigung zu mehr Geltung verschaffen, doch sind diese nicht sehr überzeugend. Nicht selten wird in dem Text die Bedeutung des internationalen Menschenrechts anerkannt. Eine vertiefte Diskussion darüber, was die UN-Menschenrechtsarchitektur darüber hinaus tun kann, um Konfliktgefahren zu thematisieren, findet sich jedoch nicht. Im Gegensatz zu den positiven Aussagen über den Sicherheitsrat, die Generalversammlung und die Kommission für Friedenskonsolidierung, wird der Menschenrechtsrat im größten Teil des Paktes überhaupt nicht erwähnt (er wird beiläufig in der Globalen Digitalisierungsübereinkunft erwähnt, die dem Haupttext als Anhang angehängt ist). Darüber hinaus einigten sich die westlichen Staaten aufgrund von Einwänden Russlands darauf, die Forderung nach einer Überprüfung der für das Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte erforderlichen Ressourcen abzuschwächen.
Die Menschenrechtsgemeinschaft muss daher bei der Interpretation von Kapitel 2 des Pakets kreativ sein (andere Teile des Pakets bieten mehr Substanz für sie). Eine interessante Möglichkeit könnte in Maßnahme 18 liegen, in der die Staaten aufgefordert werden, auf freiwilliger Basis „nationale Präventionsstrategien und friedenserhaltende Maßnahmen“ zu entwickeln und umzusetzen. Dies ist in erster Linie ein Aufhänger für die Friedensgemeinschaft, sich für die Finanzierung von Initiativen zur Konfliktprävention und -minderung einzusetzen. Es lässt sich aber auch leicht damit argumentieren, dass die Achtung der Menschenrechte ein wesentlicher Bestandteil der Friedenssicherung ist (dies überschneidet sich mit Maßnahme 7 in Kapitel 1 des Paktes, die den Schwerpunkt der Ziele für nachhaltige Entwicklung - die Entwicklung „friedlicher, gerechter und integrativer Gesellschaften“ – aufgreift wird und die Menschenrechte in den Vordergrund rückt). Für viele in New York ansässige Diplomatinnen und Diplomaten ist die Forderung des Paktes nach nationalen Präventionsstrategien ein vielversprechender Aufhänger für politische Entwicklungen. Der nächste logische Schritt wäre, dass sie sich mit ihren Amtskollegen in Genf darüber abstimmen, wie diese Gelegenheit genutzt werden kann.
Für die in Genf ansässige Diplomatie sind die Implikationen der Formulierungen des Paktes für die Abrüstung leichter zu verstehen. Die Maßnahmen 25, 26 und 27 decken ein breites Spektrum von Abrüstungsfragen ab, das von der Nichtverbreitung von Atomwaffen bis hin zur Umwandlung neuer Technologien in Waffen reicht. Einige dieser Formulierungen – z. B. bei den Atomwaffen – fügen den bestehenden Vereinbarungen nichts neues hinzu. Dennoch bietet Maßnahme 27, die sich auf die Aktualisierung der Abrüstungsstruktur der UNO konzentriert, um den jüngsten technologischen Fortschritten Rechnung zu tragen, eine Reihe von Anknüpfungspunkten für politische Initiativen in diesem Bereich.
Unabhängig davon, in welchem Bereich Diplomaten, Beamte und Vertreter der Zivilgesellschaft genau tätig sind, sollten sie sowohl in New York als auch in Genf den Zukunftspakt als Ausgangspunkt für ein friedens- und sicherheitspolitisches Unternehmertum betrachten.
Unabhängig davon, in welchem Bereich Diplomaten, Beamte und Vertreter der Zivilgesellschaft genau tätig sind, sollten sie sowohl in New York als auch in Genf den Zukunftspakt als Ausgangspunkt für ein friedens- und sicherheitspolitisches Unternehmertum betrachten. Zwar enthält der Text kaum endgültige Antworten auf die großen Krisen und beunruhigenden Tendenzen der internationalen Sicherheit von heute. Aber er enthält einige Ideen und Sätze, die kluge politische Vordenker für ihre jeweiligen Agenden nutzen können.
Über den Autor
Richard Gowan leitet die Advocacy-Arbeit der International Crisis Group bei den Vereinten Nationen und steht in Kontakt mit Diplomaten und UN-Beamten in New York.
Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die der Autoren. Sie geben nicht vor, die Meinungen oder Ansichten des Geneva Policy Outlook oder seiner Partnerorganisationen wiederzugeben.