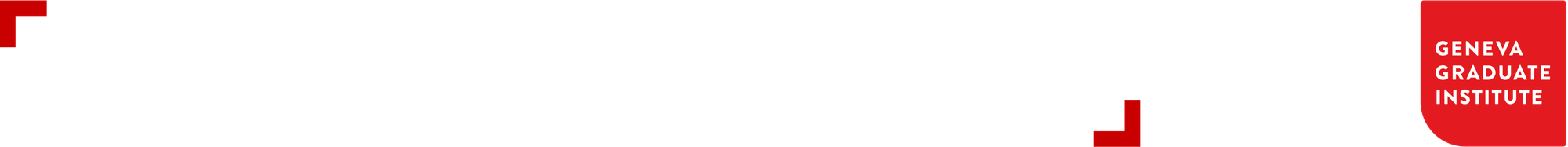Irene Ojuok und Alan Channer
Der Emissionshandel ist ein Riesengeschäft. Microsoft, Netflix, Volkswagen, Shell und AstraZeneca, um nur einige zu nennen, investieren in den Emissionshandel zur Sanierung und zum Schutz von Böden. In ganz Afrika boomen Pläne, die Waldzerstörung und Bodendegradation durch Emissionen zu reduzieren oder Kohlenstoff in Vegetation und Böden zu binden. Ob und für wen diese Pläne funktionieren, ist umstritten.
Der Emissionshandel ist ein Instrument, das als Anreiz zur Reduzierung von CO2 in der Atmosphäre eingesetzt wird. Dabei werden Gelder von Ländern, die CO2 ausstoßen, an Länder transferiert, die für mehr Kohlenstoffsenken schaffen oder erhalten oder ihre Emissionen reduzieren. Viele dieser Kohlenstoffsenken befinden sich auf Land, das die Lebensgrundlage von Kleinbauern bildet, die weniger als zwei Hektar Land besitzen. 80 Prozent der Landwirte in Afrika sind Kleinbauern, die rund 40 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Kontinents bewirtschaften. Etwa zwei Drittel dieser Fläche sind degradiert. Als der Emissionshandel die Bühne betrat, wurde er als vierfacher Gewinn gefeiert: Das Land würde saniert, die Bauern hätten ein höheres Einkommen, CO2 würde gebunden und die Kapital gebenden Unternehmen könnten auf eine Treibhausgasneutralität zusteuern.
Integration unterrepräsentierter Stimmen
So einfach war es nicht. Die Anforderung an freiwillige Emissionsprojekte sind komplex und anspruchsvoll. Die erste zwingende Voraussetzung ist die Dauerhaftigkeit – das CO2 muss mindestens für 30 Jahre gebunden bleiben. Die zweite ist die Zusätzlichkeit - ein Projekt muss zusätzliches CO2 reduzieren, das ohne das Projekt reduziert worden wäre. Die dritte Hauptbestimmung lautet “no leakage” - die Einsparung von CO2 an einem Ort darf nicht zu höheren Emissionen an einem anderen Ort führen. Zum Beispiel kann der Schutz von Bäumen an einem Ort dazu führen,dass an einem anderen Ort Bäume gefällt werden.
Die Landwirte müssen mit allen Bedingungen eines CO2-Projekts in einem Vertrag zustimmen und diesen in „freier und informierter Zustimmung“ unterzeichnen. Unerwartete Schwierigkeiten traten auf, in einigen Fällen kam es sogar zu Konflikten.
Voraussetzung für die Teilnahme an CO2-Projekten der rechtmäßige Besitz von Land. Viele afrikanische Gemeinschaften haben jedoch keinen rechtlichen Eigentumsnachweis für das Land, auf dem sie leben und das sie bewirtschaften. Zudem sind afrikanische Gewohnheits- und Erbrechtssysteme auf die Gemeinschaft ausgerichtet und lassen individuelle Besitzansprüche nicht zu. Die Einführung von Landtiteln und langfristigen Pachtverträgen kann zu Konflikten über die Nutzung von Land und Bäumen führen, da die Vertragsbedingungen die traditionelle Landnutzungs- und Siedlungsmuster stören und sich störend auf kulturelle Praktiken auswirken können. Wenn rechtliche Bedingungen nicht sensibel eingeführt und diskutiert werden, können sie Konflikte in Familien und Gemeinschaften auslösen. Da die meisten afrikanischen Frauen, die in der Landwirtschaft tätig sind, ihr angestammtes Land nie besessen haben (obwohl sie in der Regel mehr Zeit damit verbringen, es zu bewirtschaften), liegt die Zustimmung zu CO2-Projekten ausnahmslos den männlichen Familienoberhäuptern. Es ist absehbar, dass dies die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern noch verstärken wird. Darüber hinaus stellt sich die Frage der Vererbung. Junge Menschen werden oft nicht einbezogen, obwohl ihre Nutzungsrechte am Land ihrer Vorfahren bei einer Projektlaufzeit von 30 Jahren stark betroffen sind.
Schiefe Standards: Selektionsbias bei Kohlenstoffentwicklern
Zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten neigen viele CO2-Projektentwickler naturgemäß dazu, Landbesitzer mit offiziellen Landtiteln auszuwählen. Darüber hinaus können die Transaktionskosten, die bei Verhandlungen mit mehreren Kleinbauern anfallen, dazu beitragen, dass sich die Projektentwickler eher für Landwirte mit größeren Landbesitz entscheiden. Da außerdem mehr CO2 dort gebunden wird, wo das Baumwachstum besser ist - wo es mehr Niederschläge gibt und die Böden fruchtbarer sind - neigen die Entwickler dazu, landwirtschaftliche Gebiete mit geringem Potenzial zu meiden, wo mehr Geld in die Bodensanierung investiert werden muss. All diese Faktoren führen dazu, dass Landwirte, die bereits besser gestellt sind, und landwirtschaftliche Gebiete, die keine Unsicherheiten aufweisen und bereits ertragreich sind, bevorzugt werden. Dies kann Ungleichheiten verstärken und die Unzufriedenheit unter den marginalisierten Gemeinschaften schüren. Am anderen Ende des Spektrums können die Entwickler lokale Gemeinschaften ausbezahlen oder von dem Land vertreiben, das für die Kohlenstoffbindung vorgesehen ist.
Landwirte, die bereits besser gestellt sind, und landwirtschaftliche Gebiete, die keine Unsicherheiten aufweisen und bereits ertragreich sind, werden von Projektentwicklern bevorzugt.
Auch wenn CO2-Projekte bereits in vollem Gange sind, können sie noch Spannungen erzeugen. So gibt es zum Beispiel eine optimale Baumdichte für eine optimale CO2-Bindung, ohne die Ernte- oder Weideerträge zu verringern. Mit der Zeit wird der Druck auf die Landflächen zur Sicherung der Ernährung weiter zunehmen, ebenso wie die Nachfrage nach Holz. Es wäre von Vorteil, wenn Afrika genügend Holz für den Eigenbedarf produzieren könnte. Haushalte, die in großem Umfang Land und Bäume für die Kohlenstoffbindung zur Verfügung stellen, könnten zehn Jahre später feststellen, dass sie damit andere Lebensgrundlagen, die auf Landnutzung basieren, gefährdet sind. Dies wird sehr wahrscheinlich zu Konflikten zwischen und innerhalb von Gemeinschaften führen.
Den Bauern fehlt es oft an technischem Wissen und an finanziellen Mitteln, um sich bei der Vergabe von Emissionsgutschriften Gehör zu verschaffen. Eine schwache lokale Verwaltung und schlechte institutionelle Rahmenbedingungen im ländlichen Afrika können bei den Projektvereinbarungen zu mangelnder Gleichbehandlung und Transparenz bei Projektvereinbarungen führen. Viele Projekte bemühen sich um faire und nachhaltige Vereinbarungen zum Vorteilsausgleich. Verschärft werden diese Schwierigkeiten noch durch das kurzfristige Engagement der durchführenden lokalen ortsansässigen Organisationen und internationalen Nichtregierungsorganisationen (iNROs), die oft nur für fünf Jahre bleiben.
Im Rahmen der Emissionshandelsprogramme können zu einer Kommodifizierung natürlicher Ökosysteme und zu neuen Auswirkungen auf ländliche Lebensgrundlagen führen. Damit die Programme zum Nutzen aller funktionieren, müssen sich Bildung und Mentalität grundlegend ändern. Dazu ist es notwendig, die Bauern als Mitinvestoren und Mitgestalter dieser Programme zu sehen und die sozialen Normen und das lokale Wissen bei der Gestaltung des gesamten Projekts zu berücksichtigen. Der Aufbau einer solchen Zusammenarbeit erfordert Transparenz, Gleichberechtigung und Vertrauen. Das kostet viel Mühe, reduziert aber das Risiko bei der Finanzierung des Emissionshandels.
Das Ziel von Genf: Einen konfliktsensitiven Ansatz vertiefen
Es gibt einige positive Anzeichen. Einige Investoren und Projektentwickler verlangen inzwischen sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Machbarkeitsanalysen, einschließlich einer Einschätzung des Konfliktpotenzials, bevor sie mit dem Projekt beginnen. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass konfliktsensitive Ansätze in die CO2-Programme integriert werden müssen, um eine ganzheitliche und nachhaltige Landnutzung durch Kleinbauern zu erreichen.
Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass konfliktsensitive Ansätze in die CO2-Programme integriert werden müssen, um eine ganzheitliche und nachhaltige Landnutzung durch Kleinbauern zu erreichen.
Da in Genf Friedensförderung, Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, Naturschutz und Finanzinstitutionen eng miteinander verbunden sind, kann Genf eine wichtige Rolle bei der Förderung nachhaltiger und gerechter Emissionshandelsinitiativen spielen. Erfolgreiche Landrehabilitierung, die den Lebensstandard afrikanischer Kleinbauern gleichberechtigt verbessert, ist auch eine Investition in Frieden und Sicherheit.
Genf kann dazu beitragen, die Bedürfnisse ländlicher afrikanischer Gemeinschaften in der Interaktion mit mächtigen kommerziellen Interessen zum Ausdruck zu bringen. Dabei kann Genf den Schwerpunkt auf eine konfliktsensible Programmgestaltung, die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Lebensbedingungen und Interessen, partizipative Projektgestaltungsprozesse, Mechanismen für einen gerechten Vorteilsausgleich und die Risikominderung bei Investitionen legen. Genf kann dazu beitragen, die vom Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (Integritätsrate für den freiwilligen Emissionshandel) vorgeschlagenen ethischen Standards zu stärken und ihren Umfang zu erweitern.
Durch die Förderung dieser Empfehlungen kann die Genfer Gemeinschaft die Lebensqualität ländlicher Gemeinschaften in Afrika verbessern und gleichzeitig die internationalen Klimaziele unterstützen.
Über die Autoren
Irene Ojuok ist Forschungsdoktorandin am Right Livelihood College, Zentrum für Entwicklungsforschung, Universität Bonn, und Fachkundige für gemeindegeführte Landsanierung.
Dr. Alan Channer ist Berater im Nexus zwischen Friedensstiftung, Umweltsanierung und Klimawandel und leitender Wissenschaftler bei Global Evergreening Alliance.
Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die der Autoren. Sie geben nicht vor, die Meinungen oder Ansichten des Geneva Policy Outlook oder seiner Partnerorganisationen wiederzugeben.