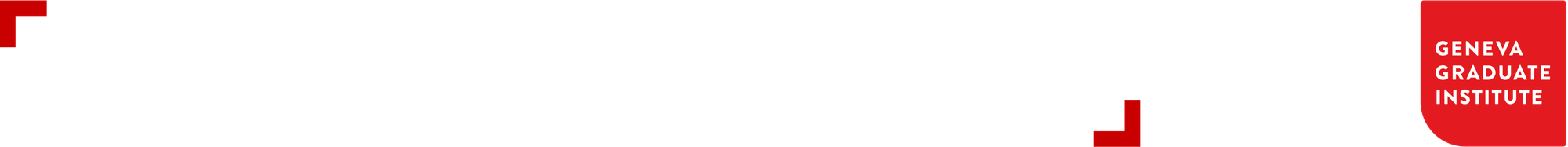Marie-Laure Salles
Am 25. September 2015 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit 17 Nachhaltigkeitszielen verabschiedet. In der Einleitung des Textes heißt es: „Es kann keine nachhaltige Entwicklung ohne Frieden und keinen Frieden ohne nachhaltige Entwicklung geben.“ Seitdem steht Nachhaltigkeit im Zentrum des Multilateralismus eingraviert und hat in vielen Teilen der Welt Eingang in den öffentlichen und den privaten Sektor gefunden. Der Begriff ist jedoch nach wie vor weit gefasst und vage genug, um ziemlich viel Raum für Interpretationen und damit für Verzögerungen oder gar Umgehungen zu lassen.
Eine Ära radikaler Unsicherheit bewältigen
Seit 2015 erleben wir eine Verschärfung und Beschleunigung der vielen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, und wir müssen uns eingestehen, dass wir bei der Bewältigung jeder einzelnen gescheitert sind. Wir stehen vor Krisen, die miteinander verknüpft sind: Klimawandel, Zerstörung der Biodiversität, extreme Ungleichheit, Desinformation und Cyber Kriege, Pandemien, Kriege, einschließlich der erneuten Gefahr eines Atomkrieges, und technologische Bedrohungen. Das sich gegenseitig verstärkende Kräftespiel zwischen diesen Krisen erzeugt die Art von radikaler Unsicherheit, die unser Zeitalter gekennzeichnet ist. Jede dieser Herausforderungen könnte für sich genommen bereits lebensbedrohliche Auswirkungen haben, ganz zu schweigen von ihrer Kombination. Selbst wenn sie das Überleben unserer Spezies nicht in Frage stellen würden, könnten sie zu einer tiefgreifenden Neudefinition des Menschseins führen.
Gleichzeitig müssen wir uns eingestehen, dass wir bei der Suche nach Lösungen und der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen von 2016 und der Agenda 2030 hinter den Erwartungen bleiben. Verschiedene Berichte deuten darauf hin, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass wir innerhalb der +1,5°C Grenze bleiben, geschweige denn innerhalb der +2°C Grenze des Übereinkommens von Paris. Aus den Arbeiten des Weltklimarates wissen wir, dass ein Anstieg von +2°C zu erheblichen Umweltschäden mit unbestreitbar dramatischen Folgen führen wird. Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen bestätigt, dass wir höchstens 17 % der Nachhaltigkeitsziele erreichen werden, die wir uns 2015 gemeinsam gesetzt haben.
Da wir uns gerade tatsächlich in einer außergewöhnlichen Zeit befinden, müssen wir vorbereitet sein und einen klaren Plan in Form einer neuen Nachhaltigkeitsagenda haben.
Nun könnte man die Aufgabe als unmöglich halten und verzweifelt aufgeben.
Oder wir könnten, mit Jean Monnet zustimmen und sagen: „In außergewöhnlichen Momenten ist alles möglich, vorausgesetzt, wir sind vorbereitet, wir sind bereit, und wir haben einen klaren Plan, und zwar dann, wenn alles unsicher erscheint.“ Da wir uns gerade tatsächlich in einer außergewöhnlichen Zeit befinden, müssen wir vorbereitet sein und einen klaren Plan in Form einer neuen Nachhaltigkeitsagenda haben.
Eine neue Agenda für Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit wird ein zentrales Thema für die Menschheit bleiben. Grundsätzlich sollten wir Nachhaltigkeit als ein sich entwickelndes Konzept verstehen, da wir als Spezies nach menschlicher und gesellschaftlicher Entwicklung streben. Aber heute muss Nachhaltigkeit tatsächlich mit dem bescheidenen, aber unverzichtbaren Ziel beginnen, den nachfolgenden Generationen mindestens die gleiche Lebensqualität zu sichern. Es ist hilfreich, Nachhaltigkeit im Sinne von Wiederverbindung zu verstehen – oder genauer gesagt: als multidimensionale Wiederverbindung. Unsere neue Nachhaltigkeitsagenda sollte neben der Wiederverbindung mit der Natur auch die Wiederverbindung mit uns selbst fördern. Nur so können wir die Hoffnung am Leben halten und das Menetekel an der Wand und die katastrophalen Aussichten für künftige Generationen vermeiden.
Unsere neue Nachhaltigkeitsagenda sollte neben der Wiederverbindung mit der Natur auch die Wiederverbindung mit uns selbst fördern.
Unsere Wiederverbindung mit der Natur bedeutet die Erhaltung unserer Biosphäre und die Achtung und Regeneration des Humus, der Erde, des Planeten, dessen Teil wir (Menschen) sind und von dem unser Wohlergehen und unser Überleben ebenso abhängt wie das der anderen Spezies. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Beitrag von Hugo Slim über eine bessere Repräsentation der Erde.
Mindestens genauso wichtig ist, dass wir uns wieder miteinander verbinden. Dies setzt die Neugestaltung eines Gesellschaftsvertrages voraus, der notwendigerweise eine globale Dimension hat – denn wir stehen heute vor Herausforderungen, die von globaler Dimension und eine globale Reichweite sind und daher Zusammenarbeit und Kooperation anstelle von Konflikt, Ungleichheit und Polarisierung erfordern.
Schließlich ist es dringend notwendig, dass wir uns wieder auf unsere Menschlichkeit besinnen, auch auf unsere Zerbrechlichkeit, die in der Vergangenheit auch unsere Stärke war. Die gegenwärtige technologische Bewegung geht einher mit der „Überwältigung“ und der Geringschätzung der Menschlichkeit und der menschlichen Fähigkeiten. Aber was ist Technologie anderes als erstarrte menschliche Intelligenz? Und was wir heute brauchen, ist eine höchst lebendige (keine rückwärtsgewandte, in der Vergangenheit erstarrte) kollektive menschliche Intelligenz, um genau die Art von tiefgehenden systemischen Veränderungen und Anpassungen zu fördern, die unsere gegenwärtige Zwangslage erfordert.
Die Agenda vorantreiben
Der Geist von Genf – eine mutige humanistische Vision gepaart mit internationaler Zusammenarbeit – war noch nie so relevant und notwendig wie heute, um unsere neue Agenda für nachhaltige Entwicklung zum Erfolg zu führen.
Unsere neue Nachhaltigkeitsagenda bedeutet, dass wir von unserem derzeitigen extraktiven Wirtschaftsparadigma hin zu einem regenerativen Paradigma übergehen.
Wir müssen unser Weltbild ändern und rasch handeln. In unserem gegenwärtigen System sind Menschen, andere lebende Lebewesen und die Natur als Ganzes zu Ressourcen und Stellschrauben für wirtschaftliches, finanzielles und technologisches Wachstum geworden. Wir müssen genau auf das Gegenteil hoffen und danach streben. Mit einem neuen Weltbild würden wir unsere immensen Fähigkeiten auf das Gedeihen, das Wohlergehen, die Würde und die Gleichheit der Menschen ausrichten und dafür einsetzen. Dabei würden wir die ökologischen Regenerationskreisläufe, die im Artikel von Chandler und Ojouk näher beleuchtet werden, in vollem Umfang respektieren. Unsere neue Nachhaltigkeitsagenda bedeutet, dass wir von unserem derzeitigen extraktiven Wirtschaftsparadigma hin zu einem regenerativen Paradigma übergehen. Das bedeutet, dass wir unseren Kompass neu ausrichten müssen – von Wachstum zu Wohlstand, von Ausgrenzung zu Inklusion, von Konkurrenz zu Kooperation, von Isolation zu Verbundenheit, von Abfall zu Recycling, von Haben zu Sein, von (monetären) Werten zu (moralischen) Werten, von einer finanziellen Definition von Erfolg zu einer Definition von positiven Auswirkungen.
Der Weg voran ist klar vorgezeichnet, nun müssen den Worten Taten folgen. Dies erfordert Führungspersönlichkeiten mit Mut, Integrität, Kreativität, Vertrauen (in sich selbst und in eine erstrebenswerte Zukunft) und einem Verantwortungsgefühl für die kollektiven Herausforderungen. Wir müssen auch die vielen Akteurinnen und Akteure und Initiativen ausfindig machen und miteinander in Verbindung bringen, die bereits Lösungen entwickelt und umgesetzt haben, mit denen wir uns in die richtige Richtung führen. Es wird notwendig sein, die Formen der internationalen Zusammenarbeit so umzugestalten, dass es gelingt, die Friedenssehnsucht der Menschheit mit der Nachhaltigkeitsagenda in Einklang zu bringen, und zwar so, dass damit Gerechtigkeit und Gleichheit, auch in der Vergangenheit, damit einhergehen. Und nicht zuletzt müssen wir die finanziellen Mittel aufbringen, die für einen so tiefgreifenden Wandel unerlässlich sind. Genf hat alles, was es braucht, um sich als Drehscheibe dieses epochalen Wandels neu zu erfinden: das Erbe, die Institutionen, den „Geist“, die Agilität einer neutralen, grenzüberschreitenden Position, die entsprechenden Bildungsressourcen und den Zugang zu den Finanznetzwerken. Diesen Aufruf dürfen wir nicht verpassen!
Über den Autor
Marie-Laure Salles ist Direktorin des Geneva Graduate Institute.
Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die der Autoren. Sie geben nicht vor, die Meinungen oder Ansichten des Geneva Policy Outlook oder seiner Partnerorganisationen wiederzugeben.